Selbstgeführte Wanderung – abwechslungsreich mit herrlichen Ausblicken
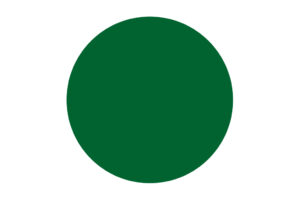 KENNZEICHNUNG:
KENNZEICHNUNG:
dunkelgrüner Punkt (#007)
STRECKENVERLAUF:
Bad Neualbenreuth – Gedankental – Hardeck – Maiersreuth – Rehberg – Hardeck – Bad Neualbenreuth
DAUER / LÄNGE:
etwa 3-4 Stunden; ca. 12 km; Höhenunterschied ca. 130 m
BESONDERHEITEN:
Gedankental – Schloss Hardeck – Badehaus Maiersreuth – 50. Breitengrad – Aussichtspunkt Rehberg – Kastanienallee

Der Rundwanderwege startet am Sengerhof auf 553m NHN und führt über den Marktplatz zum westlichen Ortsrand. Am Standort „Am Steinkreuz“ führt der Weg geradeaus ins Gedankental über die Habertsmühle bis zur Troglauer Mühle (507m) und weiter bis nach Hardeck zur Burgmühle. Nach dem Treppenaufstieg wendet sich der Weg zweimal links wieder bergab und weiter bachabwärts entlang des Muglbaches bis zum Dorfanger Maiersreuth (488m).
Am Dorfanger quert die Markierung die Staatsstraße 2175 und führt hinter dem alten Badehaus rechts wieder entlang des Muglbaches bis zum Klärwerk, biegt dort nach rechts und an der nächsten Kreuzung nach links ab. Die Markierung führt die Flurbereinigungsstraße am Waldrand immer geradeaus leicht bergan, wechselt in den Wald und überquert weiter geradeaus den 50. Breitengrad (550m).

Der Weg führt weiter bis zur nächsten Kreuzung an der Staatsgrenze und biegt dann rechts bergan in den sich zum Rehberg (612m) schlängelnden Waldweg ab. Am aussichtsreichen Waldrand biegt die Markierung nach rechts ab und führt die Flurbereinigungsstraße nach Hardeck (520m) hinein. An der Staatsstraße 2175 quert die Markierung und führt nach links den Fuß- und Radweg entlang durch die Kastanienallee den Kirchberg hinauf.
Am Ende der Allee (572m) überquert die Markierung die Straße zum Sibyllenbad und führt den Fuß- und Radweg nach links nach Bad Neualbenreuth und über den Marktplatz zum Ausgangspunkt zurück.
Aktueller Streckenverlauf seit 2021/22:
Aus Geschichte und Sagenkreis:
Der Muglbach
Ein fleißiges Wasser – dieser Bach. An der Grenze bei Neumugl tritt er zu Tage und hat in vielen tausend Jahren eines der schönsten Täler unserer Gegend gestaltet. Schon vor 700 Jahren mögen die ersten Siedler seine Kraft genutzt haben – zunächst zwar bescheiden, aber ab ca. 1500 mit Klugheit und Können: Die Habertsmühle war die fünfte Arbeitsstätte entlang des Muglbaches ab seiner Quelle: neun Hämmern und Sägen, Mühlen, Poch- und Mahlwerken stellte dieses Gewässer seine bescheidene Energie zur Verfügung, gab deren Betreibern Lohn und Brot.
Das „Stich-Kreuz“
Solche Kreuze aus Stein sind in der Oberpfalz seit dem Mittelalter bekannt. Sie werden auch als „Sühnekreuze“ bezeichnet, spiegeln religiöse Hintergründe, häufig auch Rechtsstreitigkeiten wider. Letzteres ist hier auch Grund seiner Errichtung, wobei der Standort nicht mehr genau belegbar ist:
Im Jahre 1509 hat der Untertan Fricz Stengel auf Gut Ottengrün an den Armmann (Untertan) des Christoff von Tein, böhmischer Lehensträger zu Kinßpergk (heute: Hrozňatov (Kinsberg) unmittelbar hinter der Grenze in Richtung Eger), Paul Goßler, einen Totschlag verübt. Am Donnerstag nach dem heiligen Pfingsttag ist durch die Ältesten des ehrbaren Rats der Stadt Eger über diesen Justizfall wie folgt befunden worden:
– Der Mörder hat für sein in Neualbenreuth begrabenes Opfer dort vier Seelenmessen lesen zu lassen. Weiter sind von ihm in einem Kloster zusätzlich zehn Totenmessen zu bestellen
– Dergleichen ist ein steinernes Kreuz am Tatort zu errichten
– Auch ist eine Romwallfahrt und eine Aachenfahrt vom Mörder zu unternehmen, wobei ein Beweis mitzubringen ist
– Den Hinterbliebenen sind 15 Schock Groschen in drei Raten binnen eines Jahres zu zahlen
Mit diesem Kreuz und den horrenden Auflagen, auch Seelgerät und Manngeld genannt, waren Tat und Blutrache gesühnt.
Das Steinkreuz am Ortsausgang ist zeichen- und inschriftenlos und lag lange Zeit von Strauchwerk überwuchert im Straßengraben. Es wurde erst 1973 nach Hinweisen aus der Bevölkerung ausgegraben und 1974 wieder aufgestellt.Sie wandern am Feldrain entlang hinunter zur Habertsmühle. Kurz vor der Habertsmühle folgen Sie dem Muglbach nach rechts.
Die Sage vom Burgholz
Im Burgholz unterhalb der Burg Hardeck war einst ein Bergwerk. Dort hatte der Zwergenkönig sein Schloss. Ein Zwerg verliebte sich in die Dienstmagd Nanni Webermatzn von Hardeck. Er folgte ihr überall hin bis in ihre Kammer. In Neualbenreuth lachte deshalb Groß und Klein über sie. Man nannte sie auch Zwergen-Nanni oder Wichtelbraut.
Die Nanni versuchte sich zu wehren und ihn loszuwerden. Der Zwerg aber würde nur von ihr lassen, wenn sie seinen Namen erraten würde. Dieser war sehr ungewöhnlich. Durch einen Zufall hörte ein Neualbenreuther Bursche eines Morgens das Männlein singen: „Wenn mein Dirnderl weiß, dass ich Dienzel Deinzel heiß, so lassts mich nimmer nei, so bin ich ganz allei.“
Als wie jeden Abend der Zwerg kam – lachte Nanni ihn an und sagte ihm seinen Namen gradheraus. Der Zwerg gab ihr eine Ohrfeige, krachend fiel die Türe zu und er wurde nimmermehr gesehen.
(Sage nach „Sagen und Legenden im Landkreis Tirschenreuth“, Harald Fähnrich)
Die Breitengrade
Die Breitengrade ziehen sich wie mehrere Gürtel um den Globus. Der größte ist am Äquator, genau zwischen Nord- und Südpol. Er teilt die Welt in Nord- und Südhalbkugel. Zu den Polen hin werden die „Gürtel“ immer enger. Die Breitengrade geben die Position in Nord-Süd-Richtung an. Der Äquator ist der nullte Breitengrad. Von da aus zählt man jeweils bis neunzig Grad an Nord- und Südpol. Auf der Nordhalbkugel spricht man zum Beispiel von 50 Grad nördlicher Breite – auf diesem Breitenkreis liegt Frankfurt am Main. Auf der Südhalbkugel liegen auf 50 Grad südlicher Breite nur wenige Orte – zum Beispiel die argentinische Stadt Santa Cruz.
Seefahrer, die nichts weiter zu ihrer Orientierung hatten als Sonne, Mond und Sterne, konnten den Breitengrad leicht bestimmen. Es gab dafür einfache Geräte wie den Jakobstab oder einen Sextanten. Damit maßen sie den Winkel zwischen Horizont, Schiff und der Mittagssonne oder dem Polarstern. Mithilfe von Tabellen konnten sie dann ihren aktuellen Breitengrad ablesen.
Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf die Erde ist je nach Breitengrad und Jahreszeit verschieden. Zweimal im Jahr steht die Sonne senkrecht über dem Äquator– am 20. / 21. März und am 22. / 23. September. Am 21. Juni ist der Tag der Sommersonnenwende; dann steht sie senkrecht über dem nördlichen Wendekreis. Dasselbe passiert am 21. Dezember über dem südlichen Wendekreis.
Das Schloss Hardeck
Das Schloss bzw. die Burg Hardeck erhebt sich auf einem Phyllitfelsen, der nach Süden ins Tal des Muglbaches steil abfällt. Es ergibt sich dadurch mehr Burg- als Schlosscharakter.
Die Entstehung fällt vermutlich ins 11./12. Jahrhundert. 1316 wurde die Burg von Landgraf Ulrich von Leuchtenberg mit allen Zugehörigkeiten an Abt Johann III. vom Kloster Waldsassen verkauft, der diese zu seiner Wohnstätte machte. Damit erwarb das Kloster auch alle Lehen, die zur Burg gehörten: neun Lehen in Neualbenreuth, Güter in Gosel, Altalbenreuth und Drasnitz, sowie die Orte Schachten, Boden und Mugl. Wegen großer Schulden war der Nachfolger von Johann III., Abt Franz Griebel, gezwungen, neben anderen Stiftsgütern auch Hardeck mit den dazugehörigen Orten zu veräußern. Es ging über in den Besitz eines Egerer Bürgers und ein Jahrzehnt später konnte es Abt Nikolaus mit der Hilfe des Kaisers wieder zurückkaufen.
Nachdem 1430 die Hussiten das Kloster völlig ausgeraubt hatten, wurde Hardeck samt der dazugehörigen Dörfer abermals verkauft. Das Bauwerk hatte im 30jährigen Krieg stark gelitten. Abt Albert Hauser ließ es 1708 in seiner jetzigen Form wieder herstellen. Die Klosterherren weilten hier und im Lustschlösschen des Gartens oft und gern und nutzten es als Sommersitz.
Seit 1360 bildete die Burg Hardeck einen Gerichtssprengel des Stifts Waldsassen, also einen Sitz des Klostergerichts. In einem Gebäude, neben der Burg bergauf, ist heute noch das Gefängnis ersichtlich.
Eine Inschrift auf einer Tafel über der Tür lautet: „Operantibus praefecturae subditis aedes istae justiae funditus structae sunt“ – d.h. Unter Mitarbeit der Untertanen des gesamten Amtsbereiches wurde dieses Gerichtsgebäude von Grund auf errichtet.
Diese Inschrift bezieht sich auf den Bau des Gerichtsgebäudes unter Abt Alexander Vogel im Jahr 1754.
Bis zur Säkularisation im Jahr 1802 blieb Hardeck beim Kloster Waldsassen, dann wurde es verstaatlicht. Die Grundstücke wurden verkauft, ebenso die Wirtschaftsgebäude, die Mühle, die Säge, das Forsthaus und das Gerichtsgebäude. Die Burg selbst war von 1803 bis 1847 vermietet. Dann wurde sie von dem Färbermeister Johann Ruderer gekauft, der eine Färberei einrichtete, die bis 1905 bestand. 1873 erhielt dessen Schwiegersohn Johann Söllner das Schankrecht und betrieb eine Gastwirtschaft, die auch von seinen Nachfahren noch weiter betrieben wurde.
Brückenheiliger Nepomuk
Am Baum rechts unmittelbar an der Brücke des Bodener Bachs ist in einem Schrein der heilige Johannes Nepomuk angebracht. Neben der Patrona Bavariae und dem Heiligen Benno ist er der dritte Landespatron Bayerns und wird auch als Brückenheiliger verehrt. Angesichts der vielen Fuhrwerke und des seinerzeit beschwerlichen Weges von Bad Neualbenreuth herunter wird es wohl diesen Grund gehabt haben, weshalb die Heiligenfigur gerade an der Erlbrücke angebracht worden ist.


